| Inhalt 2010 - 2012 | Home |
Christine Winterholler, 1984, Köln
DrehmomentDie Jahre der Kindheit sind die Jahre der Sorglosigkeit. Sobald ich weiß, dass ich sterben werde ist die Kindheit vorbei. Die Vorstellung vom Tod meiner Eltern war die Schlimmste. Mit sieben Jahren ist man also erwachsen. Von da an beginne ich das zu verdrängen, was ich begriffen habe. Bei manchen dauert das ein ganzes Leben lang. Die große Pause in der Grundschule. Eine Viertelstunde – ein ganzer Tag voller Inhalt,Zeit genug, um das eine Spiel zu spielen, immer und immer wieder. Heute nehme ich eine Viertelstunde nicht einmal wahr. Und trotzdem laufe ich ihr in der Hoffnung hinterher, das Leben einzufangen, es zu halten, es fest zu halten. Den Augenblick, die Gegenwart an mich binden. Seitdem ich die Zeit entdeckt habe, gibt es keine Gegenwart, nur die Vergangenheit und diese geht gleich in die Zukunft über. In der Vergangenheit drehte sich alles um mich. Die Sterne und die Sonne, das Herbstlaub, Sommer und Winter, Mutter und Gott, sie alle drehten sich und ich war es, die im Mittelpunkt blieb. Unbeweglich. Aufgeweichte Brotkrumen in der Krautsuppe, die Hitze des Backofens, Salamischeiben und Mutters Haut. Ich vergrabe mein Gesicht darin, atme den Pizzateig nicht, auch keine Geborgenheit. Vielleicht hätte ich mich nicht rühren sollen. Mutter ist gestorben und Gott mit ihr. Manchmal gelingt es mir, das zu greifen, was von der Kindheit übrig ist: Ein Stück Gegenwart in einer Schale Cornflakes. Es sind Momente nur. Momente, die ewig sind. Wie ich vor dem offenen Gartentor stehe und auf meine Unterlippe beiße, wie ich den schmalen Weg betrete, der zu ihrem Haus führt. Uneben gepflastert, zwischen den Steinen wächst Unkraut. Efeu und verblühter Flieder. Das Herbstlaub bewegt sich nicht. Wie ich in ihre Wohnung komme und der Fernseher schreit. Sie sieht mich und lächelt. „Hallo.“, stottert sie, greift nach der Fernbedienung, greift daneben. Wir begrüßen uns wie alte Freunde, mit einem Küsschen links und rechts. Inzwischen kann ich das. Ihre Finger flattern, während sie versucht meine Schultern zu umfassen, mich einen Augenblick fest zu halten. Der Nagellack blättert ab. Ich schalte den Fernseher aus und es wird still. An der Wand hängt eine Stickerei: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sie packt die Gehhilfe und wir wandern in die Küche. Aus dem Küchenschrank holt sie Zitronenkuchen vom Plus und aus der Schublade ein Messer. Der Backofen bleibt kalt. Ich nehme ihr das Messer aus der Hand. Ich will nicht, dass sie den Kuchen schneidet. Dann bringe ich sie, den Kuchen, die Klappstühle und den Klapptisch in den Garten, erzähle Geschichten aus dem Büro, sie hört zu und fragt, ob ich Karriere mache. „Vielleicht.“, antworte ich und gieße etwas Wasser in ihr Glas, nicht zu viel, sie würde es verschütten. Seitdem sie die Narbe auf dem Kopf hat, verschüttet sie alles. Normalerweise trägt sie eine Mütze, wenn ich komme und eine Perücke, wenn wir das Haus verlassen. Die Leute aus Chorweiler glotzen ihr nach. Heute hat sie ihre Mütze nicht auf. Nächste Woche wird sie 52 und ich bin eingeladen. Sie wünscht sich Manjok und Apfelkuchen. Nächste Woche habe ich keine Zeit. Ich frage sie nach ihrer Kindheit. Sie nickt und ihre Augen verlieren sich irgendwo in dem Raum zwischen dem Kuchen und mir. Ein Stück Kuchen fällt in ihren Schoß. Sie greift danach, führt es langsam zum Mund. Sie redet schwerfällig und undeutlich. Der Krieg habe vieles zerstört. Davor wäre das Leben besser, angenehmer gewesen. Mit 14 war sie zum ersten Mal schwanger. Ob ihr das Leben in Deutschland gefällt? Sie nickt. Sie mag Chorweiler und die Menschen dort. Über uns kurvt ein Flugzeug. Köln-Bonn Airport. Lieber würde sie zurück, der Rollstuhl ist unpraktisch. Das nächste Stück Zitronenkuchen fällt in ihren Schoß. Mit zitternder Hand greift sie danach. Die gelben Krümel, helle Punkte auf ihrer Haut, zerbröseln. Während sie nach dem Kuchen fischt, wünsche ich mir, es wäre Zukunft. Zukunft um 20 Uhr und ich sitze in der Bahn. „Ich werde immer besser, hat der Arzt gesagt.“, berichtet sie stolz, während sie kaut. Wir bleiben in der Gegenwart. Ich frage: „Et toi, tu crois au Dieu?" Sie mag es, wenn wir französisch sprechen. Die vielen Jahre in Deutschland haben sie aus der Übung gebracht und meinem Schulfranzösisch tut es gut. Ich frage nach Sartre und Nietzsche. Kennt sie nicht. Sie erzählt von Gott. Ich schaue sie an und höre nicht zu. Die Gummigriffe der Gehhilfe, die Kerbe in ihrem Kopf. Wie mag es sein, wenn ich zum vierten Mal mit der Gabel den Kuchen nicht treffe? Wenn ich das Wasser verschütte? Der Fernseher schreit, die Tage drehen sich, immer die gleichen Tage, leer, inhaltslos, immer und immer, 24 Stunden, einen Augenblick. Ewig. Die Jahreszeiten kehren nicht wieder. Und ich stehe im Zentrum. Bewegungsunfähig. In der Vergangenheit verliere ich mich, ich verliere die Gegenwart und die Zukunft. Die Vorstellung vom eigenen Leben ist die Schlimmste. Dann niest sie. Niest die Kuchenkrümel über den Tisch hinweg, niest mich an. Ich erstarre und presse die Lippen aufeinander. Es ist kühl geworden, wir frösteln und ich bringe sie, die Klappstühle und den Klapptisch in die Wohnung. Bevor ich gehe, erinnere ich sie an ihre Medikamente. Wir verabschieden uns wie alte Freunde, mit Küsschen links und rechts. Ihre Haut ist warm. „Es war sehr schön.“, sagt sie und ich bewege mich eine Gegenwart lang nicht. Dann schalte ich den Fernseher ein und sie setzt sich davor. Um 20 Uhr ist Zukunft und ich sitze in der Bahn. Es beginnt zu regnen. Eine Viertelstunde - Florastraße. Die Sonne verschwindet an der Ecke Sollmannstraße. Ich rühre mich und die Momente kehren zurück. Anfangs nur kurz, verflüchtigen sich, wie der Sommer in jedem Jahr einmal. Hinter den Tropfen auf der Fensterscheibe verschwimmen die Lichter der Straße. Die Ampel leuchtet gelb, dann rot. An jeder Haltestelle einmal, immer wieder. Dann steige ich aus. Auf der Straße dreht sich das Laub.
|
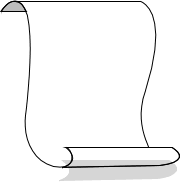 |
